Fünf Gründe für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr

Ein sozialer Pflichtdienst kann die gesellschaftliche Teilhabe fördern und den Zusammenhalt stärken. In einem Gastbeitrag für epd sozial plädiert die stellvertretende VdDD-Vorsitzende Johanne Hannemann für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr.
Hinweis: Dieser Text erschien zunächst am 11. August 2025 bei epd sozial.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das Thema äußere Sicherheit wieder in den Fokus gerückt. Die Sorge wächst, dass sich die Aggression auch auf NATO-Staaten ausweiten könnte. Deutschland muss sich auf einen möglichen Ernstfall vorbereiten. Vor diesem Hintergrund wird die Wiedereinführung der Wehrpflicht breit diskutiert.
Doch statt allein auf militärische Optionen zu blicken, sollten wir die Frage in einen größeren Rahmen stellen: Brauchen wir nicht vielmehr eine allgemeine Dienstpflicht, die alle jungen Menschen verpflichtet – unabhängig von Geschlecht und bevorzugtem Einsatzbereich – einen Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten?
Eine solche Pflicht könnte vielfältige positive Wirkungen haben – für unsere Sicherheit, den Sozialstaat und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dazu führen wir fünf Gründe an:
1. Investition in soziale Sicherheit
Deutschland steht nicht nur sicherheitspolitisch vor Herausforderungen von außen, sondern sieht sich auch im Inneren strukturellen Problemen gegenüber. Der Sozialstaat ist unter Druck – nicht nur durch Reformstau und Haushaltsdefizite, sondern auch durch einen dramatischen Personalmangel. Trotz steigender Ausbildungsvergütungen in der Diakonie gelingt es vielfach nicht, ausreichend Nachwuchs für Pflege, Erziehung oder den Rettungsdienst zu gewinnen – ein Problem, das der demografische Wandel noch verschärft.
Studien zeigen jedoch: Wer im Rahmen eines Freiwilligendienstes erste Erfahrungen in sozialen Berufen sammelt, entscheidet sich deutlich häufiger für eine entsprechende Ausbildung.
2. Stärkung der Geschlechtergerechtigkeit
Die Wiedereinführung einer Wehrpflicht nur für Männer erscheint vor dem Hintergrund der Geschlechtergerechtigkeit längst nicht mehr zeitgemäß. Eine Ausweitung würde aber eine Verfassungsänderung erforderlich machen. Zwar ist auch die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres an hohe rechtliche Hürden geknüpft – doch sie würde mehr jungen Menschen auch unabhängig von ihrer Wehrdiensteignung Gelegenheit geben, sich für die Gesellschaft zu engagieren und wäre daher gerechter. Gleichzeitig könnten so auch mehr Männer für soziale Berufe gewonnen werden. Denn bislang sind Freiwilligendienste überwiegend weiblich geprägt: Der Frauenanteil im Bundesfreiwilligendienst (BFD) und im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) liegt jeweils bei rund 60 bis 65 Prozent.
3. Sozialen Zusammenhalt fördern
7,5 Prozent der Jugendlichen (626.000) zwischen 15 und 24 Jahren absolvieren weder eine Ausbildung noch gehen sie einer anderen bezahlten Tätigkeit nach. Die Gründe sind vielfältig, doch die Auswirkungen können gravierend sein: Fehlende berufliche und soziale Perspektiven können junge Menschen verunsichern und das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen schwächen. Sie werden anfälliger für Populismus und extremistische Strömungen. Ein verpflichtender gesellschaftlicher Dienst kann hier ansetzen: Er kann gesellschaftliche Teilhabe fördern, neue Perspektiven eröffnen und den Zusammenhalt zwischen jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebenswirklichkeit stärken.

Über die Autorin
Johanne Hannemann ist Geschäftsführerin der Diakonie Nord Nord Ost in Lübeck und stellvertretende Vorsitzende des Verbandes diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD).
4. Integration stärken
Eine allgemeine Dienstpflicht kann sich auch positiv auf die Integration junger Migrantinnen und Migranten auswirken: Sie bekommen neue Zugänge zur Mehrheitsgesellschaft und nehmen wahr, dass sie einen aktiven Beitrag zum Sozialstaat leisten können. Umgekehrt können Menschen, die von diesem Einsatz profitieren, ein vielleicht neues, und mit guten Erfahrungen hinterlegtes Bild von Migrantinnen und Migranten bekommen.
5. Freiwilligkeit allein reicht nicht aus
Die Erfahrungen nach der Aussetzung der Wehrpflicht belegen: Freiwilligkeit allein reicht nicht, um strategisch wichtige gesellschaftliche Aufgaben personell abzusichern. Der Anteil junger Menschen, die nach der Schule lieber als Ungelernte ins Berufsleben starten, ist etwa doppelt so hoch wie jener der Freiwilligendienstleistenden. Das liegt auch daran, dass die verfügbaren Angebote nicht ausreichend bekannt sind und der Nutzen in einem „Orientierungsjahr“ vielfach nicht erkannt wird. Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr würde dafür sorgen, dass sich alle jungen Menschen mit den verschiedenen Optionen, ob in Pflege, Bildung, Umweltschutz oder Katastrophenhilfe, ernsthaft auseinandersetzen. Das stärkt die individuelle und gesellschaftliche Verantwortung gleichermaßen.
Fazit: Gemeinwohl braucht Beteiligung
Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr wäre ein starkes Signal für ein neues Miteinander – in der Verteidigung nach außen wie im Zusammenhalt nach innen. Es kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und das Bewusstsein für solidarisches Handeln schärfen.
Natürlich erfordert ein solches Vorhaben politische Entschlossenheit, eine breite gesellschaftliche Debatte, gesetzliche Anpassungen – und nicht zuletzt erhebliche finanzielle Mittel. Doch die Investition lohnt sich: für die Sicherheit, die Resilienz und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.
Das könnte Sie auch interessieren

Kirchliche Selbstbestimmung durch Bundesverfassungsgericht gestärkt!

Digitalisierung der Pflege – Chancen bleiben ungenutzt

Spurwechsel statt Abschiebung

Neues aus diakonischen Unternehmen
Personalwechsel in diakonischen Unternehmen
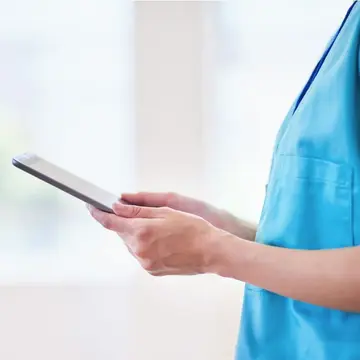
Politik trifft Praxis – Startet die Digitalisierung der Pflege jetzt durch?

Sozial-Investitionen stärken die Wirtschaft

Mit nachhaltiger Kleidung CO2 und Abfall sparen

Ankommen, um zu bleiben
