Gemeinsam die Digitalisierung voranbringen

Digitalisierte Prozesse, KI und Robotik haben das Potenzial, die Gesundheits- und Sozialwirtschaft zu revolutionieren und effizienter zu machen. Doch dafür braucht es geeignete Rahmenbedingungen – und die Bereitschaft zur Veränderung. Ein Standpunkt von Uwe Mletzko, Vorstandsvorsitzender und Direktor der Evangelischen Stiftung Alsterdorf.
Als ich den Vorstandsvorsitz bei der Evangelischen Stiftung Alsterdorf antrat, waren wir vom papierlosen Büro noch meilenweit entfernt. Auch eine Strategie für das Thema Digitalisierung gab es noch nicht konkret. Inzwischen hat sich einiges getan – und wir sind noch lange nicht fertig:
- Verwaltungsprozesse werden verschlankt.
- Die interne Kommunikation mit den Mitarbeitenden wurde auf ein Social Intranet übertragen und Kollaborationsplattformen ermöglicht.
- E-Learning als übergreifende Lernplattform nicht nur für Pflichtschulungen macht intelligente individuelle Lernsettings möglich.
Zudem prüfen wir interne Lösungen zur Anwendung Künstlicher Intelligenz. Die Pflegedokumentation mit Kugelschreiber und Papier wird bald wie in vielen anderen Sozialunternehmen der Vergangenheit angehören. In unserem Fall haben wir direkt mit einem Start-Up zusammengearbeitet, das durch das Feedback der Pflegekräfte die App mit Sprachsteuerung und direkter Anbindung an unser Dokumentationssystem weiterentwickelt hat. Wir sind auf gutem Wege mit hoher Zufriedenheit und spürbarer Zeitersparnis, die den Senior*innen zugutekommt. Das ist ein echter Gewinn!
Digitale Teilhabe ermöglichen
Im Bereich der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen testen wir ständig neue Möglichkeiten aus, die die Teilhabe am Leben erweitern. Ein Beispiel ist der MotionComposer, ein hochsensibler Bewegungssensor, der minimale Bewegungen in akustische Signale, beispielsweise Instrumente oder (Natur-)Geräusche, umwandelt. So können auch Menschen mit starken Beeinträchtigungen gemeinsam musizieren. Auch die Videoassistenz gewinnt an Bedeutung und ermöglicht unseren Klientinnen und Klienten, digital und spontan Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen, ohne auf den nächsten persönlichen Termin warten zu müssen.
Während manche etablierten Tools – wie z. B. Kommunikationshilfen per Augensteuerung – über die Krankenkassen beantragt und finanziert werden können, ist die Anschaffung anderer Geräte häufig nur durch Spenden möglich.
Über die Evangelische Stiftung Alsterdorf
Die Evangelische Stiftung Alsterdorf ist mit 7.000 Mitarbeitenden das größte diakonische Unternehmen in Norddeutschland und bietet Assistenz-, Wohn- und Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung sowie Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe. Medizinische und therapeutische Behandlungen in den Krankenhäusern der Stiftung gehören ebenso zum Schwerpunkt der Arbeit wie Bildungsangebote in Kindertagesstätten und Schulen sowie Seniorenhilfe und Pflege.
Prozesse sollen einfacher werden
Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie 2024-28 gehört die Digitalisierung zu den zentralen Handlungsfeldern. Das Ziel: Jede digitale und technische Innovation soll nah an den Menschen sein und sich an ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten orientieren. Wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden spüren, dass auf diese Weise Prozesse für sie einfacher werden. Das muss der Maßstab für eine Zufriedenheit und Bindung von Mitarbeitenden sein. Wenn wir Digitalisierung in diesem Sinne gut nutzen, können wir aufwändige Prozesse vereinfachen und manche hausgemachten Probleme besser lösen.
Starre Fristen hemmen die Umsetzung
Doch jede digitale Innovation bedeutet auch erstmal Investitionen. Ich muss mich aus unterschiedlichen Perspektiven mit den Prozessen auseinandersetzen. Das bindet viele Kräfte und Zeit. Die Einführung, aber auch der Betrieb von Hard- und Software kosten Geld. In Hamburg haben wir das Glück, dass in der Eingliederungshilfe Digitalisierung als Teilprojekt des Trägerbudgets verankert wurde und klare Ziele formuliert wurden. Auch im Bildungs- und Gesundheitswesen gibt es entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten. Der Haken: Bei politischen Vorhaben wie beispielsweise dem DigitalPakt Schule oder auch im Krankenhausbereich gibt es zeitliche Fristen für die Umsetzung, die eine Herausforderung darstellen können, wenn beispielsweise die benötigten externen Partner nicht verfügbar sind. Auch der Beantragungsweg bedeutet häufig einen hohen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, der nicht vergütet wird. Die dafür benötigten personellen Ressourcen sind dann seitens der Träger vorzuhalten.
Für digitale Innovationsbudgets
Vereinfachte Antragsverfahren und bundesweit anwendbare Innovationsbudgets wären hilfreich – ebenso eine Berücksichtigung der digitalen Betriebskosten in der Regelfinanzierung.
Der Politik sollte klar sein: Sowohl das Ziel der Klimaneutralität als auch die Digitalisierung lässt sich nicht zum Nulltarif in der Sozialwirtschaft umsetzen. Es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung. Dazu sind aber die sozialen Unternehmen bereit. Doch auch mit der Verabschiedung des Sondervermögens für Infrastruktur, das den digitalen Raum miteinschließt, sollten wir uns keine Illusionen machen: Der Investitionsstau in den öffentlichen Einrichtungen ist bereits so umfassend, dass ich nicht mit nennenswerten Zuflüssen in unsere Branche rechne. Wir müssen also selbst aus den vorhandenen Möglichkeiten das Beste machen – und parallel trotzdem weiterhin politisch Druck ausüben. Wo haben wir ein Eigeninteresse, um Prozesse zu verschlanken und diese effizienter zu machen? Wenn wir ehrlich sind, besteht da in unseren eigenen Unternehmen viel Potenzial zur Vereinfachung.
Zur Person

Pastor Uwe Mletzko ist seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen diakonischen Unternehmen tätig, seit 2022 als Vorstandsvorsitzender und Direktor der Evangelischen Stiftung Alsterdorf.
Hinweis

Dieser Text erschien zunächst am 14. Mai 2025 im VdDD-Mitgliedermagazin "diakonie unternehmen" 1/25.
Das könnte Sie auch interessieren

Spurwechsel statt Abschiebung

Neues aus diakonischen Unternehmen
Personalwechsel in diakonischen Unternehmen
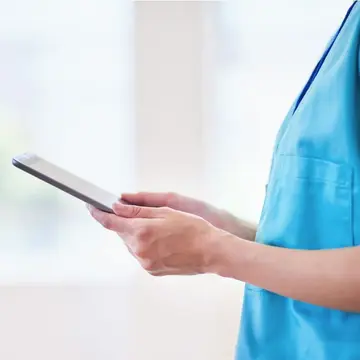
Politik trifft Praxis – Startet die Digitalisierung der Pflege jetzt durch?

Sozial-Investitionen stärken die Wirtschaft

Fünf Gründe für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr

Mit nachhaltiger Kleidung CO2 und Abfall sparen

Ankommen, um zu bleiben

Innovation trotz(t) Spardruck
