Spurwechsel statt Abschiebung

Hans-Peter Daub, Vorstand der Dachstiftung Diakonie, fordert eine konsequente Weiterentwicklung des Spurwechsels. Statt gut integrierte Geflüchtete abzuschieben, müsse die Politik ihnen den Weg in Ausbildung und Arbeit öffnen.
Hinweis: Dieser Text erschien zunächst am 7. Oktober 2025 bei Wohlfahrt Intern.
Das Erschrecken in der Öffentlichkeit ist groß, wenn deutsche und europäische Asylgesetzgebung gelungene Integration konterkariert. Das entspricht nicht dem gesellschaftlichen Konsens, selbst wenn in Umfragen eine Migrationswende gewünscht wird. Aber in der Logik des Asylrechts ist es folgerichtig: Wo Abschiebungen als Beleg einer konsequenten Migrationspolitik gelten, trifft es ausgerechnet diejenigen, die integriert und greifbar sind.
Das zeigt nicht zuletzt das Beispiel von gleich zehn Mitarbeitenden aus Kolumbien aus einer Einrichtung bei Bremen, die bei ihrer Einreise Asyl beantragt hatten und plötzlich zusammen abgeschoben werden sollten. Ihre Abschiebung hätte die Schließung der Einrichtung bedeutet. Erst unter bundesweitem politischem Druck konnte dies abgewendet werden. Eine Ausbildungsduldung war der vorläufige Ausweg.
Fachkräftemangel abfedern
Deutschland ist dringend auf ausländische Fachkräfte angewiesen, besonders in sozialen Berufen. Dennoch werden gut integrierte Geflüchtete häufig abgeschoben, obwohl sie in Ausbildung oder Arbeit stehen. Dabei bietet das Ausländerrecht Regelungen, die solche Schicksale vermeiden und zugleich unserer Gesellschaft zugutekommen. Statt Abschiebungen zu forcieren, sollte die Politik den sogenannten Spurwechsel stärken, um den Fachkräftemangel abzufedern.
Der Spurwechsel ermöglicht Geflüchteten, das Asylverfahren zu verlassen und eine Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit zu beantragen. Seit 2023 ergänzt zudem das Chancenaufenthaltsrecht den Spurwechsel. Es richtet sich an Geduldete, die mehrere Jahre in Deutschland sind, aber keinen dauerhaften Status erreicht haben. Beide Instrumente ermöglichen einen gesicherten Aufenthalt durch Arbeit oder Ausbildung. Doch restriktive Details wie Stichtagsregelungen hindern ihre volle Wirkung.

Über den Autor
Hans-Peter Daub ist Vorstand der Dachstiftung Diakonie und Vorstandsmitglied des Verbandes diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD).
Ohne Zuwanderung droht Zusammenbruch
Das schadet sowohl den Betroffenen als auch unserer Gesellschaft. Denn ohne Zuwanderung schrumpft das Arbeitskräftepotenzial. Wirtschaftswachstum und Sozialstaat geraten unter Druck. Schon heute fehlen hunderttausende Fachkräfte, bis 2030 werden allein in der Pflege bis zu 500.000 Kräfte benötigt. Ohne Zuwanderung würden bereits heute viele Bereiche kollabieren. Besonders für die sozialen Berufe in Deutschland ist es schädlich, das Potenzial der bereits in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten nicht zu nutzen.
Ein häufiges Argument gegen eine solche Öffnung des Arbeitsmarktes für Geflüchtete ist der sogenannte ‚Pull-Effekt‘. Verbesserte Arbeits- oder Lebensbedingungen würden demzufolge mehr Menschen zur Einwanderung in die Sozialsysteme bewegen. Empirisch ist das klar widerlegt. Der Ansatz, Geflüchtete möglichst lange mit wenig Unterstützung hinzuhalten, ist nicht nur inhuman, sondern auch lebensfremd und vergeudet gesellschaftliche Ressourcen. Kein Mensch kann auf Dauer ‚nichts‘ machen. Wer Integration verweigert, schafft genau die ausweglosen Randlagen, die später beklagt werden.
Für Einwanderer unattraktiv
Auch schadet ein solcher Umgang mit Migrantinnen und Migranten der gezielten Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. So sinken gegenwärtig die Zuwanderungszahlen deutlich unter das benötigte Niveau von 400.000 Menschen im Jahr. Und das gilt trotz Ukrainekrieg, den Konflikten im Nahen und Mittleren Osten und den Anstrengungen zur Arbeitskräfteanwerbung. Zuletzt meldete das Statistische Bundesamt einen deutlichen Anstieg der positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren für ausländische Berufsabschlüsse. Doch auch dies deckt bei Weitem noch nicht den Bedarf. Eine Politik, die fast täglich Migration zum Problem erklärt und integrationsfördernde Instrumente infrage stellt, gefährdet Deutschlands Attraktivität als Einwanderungsland.
Dabei gibt es für den Spurwechsel gute Vorbilder wie die sogenannte Westbalkan-Regelung. Sie ermöglichte Zuwanderern etwa aus Albanien oder dem Kosovo zwischen 2016 und 2023 die direkte Arbeitsmigration. Die Beschäftigungsquote lag rasch über dem Durchschnitt, nur drei Prozent der Zugewanderten bezogen am Ende des Zeitraums Sozialleistungen. Ein ‚Pull-Effekt‘ in die Sozialsysteme ist nicht nachweisbar. Klare Regeln und gezielte Integrationshilfen, etwa das Vorliegen eines konkreten Jobangebots, haben diese Migrantinnen und Migranten beeindruckend schnell zu Beitragszahlern in die deutschen Sozialsysteme gemacht.
Evidenzbasierte Lösungen nutzen
Diese Erfahrungen zeigen, dass klare Regeln und Integrationshilfen funktionieren und genau hier liegt die Stärke des Spurwechsels. Er nutzt vorhandenes Potenzial, beschleunigt Integration, entlastet die öffentlichen Haushalte und untergräbt dabei weder das Asylrecht noch schafft er nennenswerte Fehlanreize. Statt sich von populistischen oder rassistischen Narrativen beeindrucken zu lassen, sollte die Politik auf evidenzbasierte Lösungen setzen, die der Aufnahmegesellschaft und den Geflüchteten zugutekommen. Der Spurwechsel ist dafür essenziell und muss weiterentwickelt werden. Es ist Zeit, die Grauzone zwischen Asyl- und Arbeitsmigration nicht länger mit befristeten Notlösungen zu verwalten, sondern sie durch eine tragfähige Brücke zu ersetzen zum Nutzen aller.
Doch statt diesen Weg konsequent fortzusetzen, werden die Fortschritte politisch in Frage gestellt. Flüchtling zu sein ist keine Eigenschaft, sondern ein meist „irreguläres“, schweres Schicksal. Menschen, die ihr Land verlassen mussten, wollen diesen Ausnahmezustand überwinden und am neuen Ort zugehörig werden. Darum ist es Kern eines humanitären Flüchtlingsrechts, Wege zu eröffnen, wieder mehr sein zu dürfen als nur Flüchtling. Die Genfer Flüchtlingskonvention als humanitäres Bollwerk verhindert oftmals Rückführungen von nicht anerkannten Flüchtlingen in Länder, in denen für sie dennoch eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Aber die Betroffenen bleiben in einem unsicheren Status – ein Zustand auf unabsehbare Zeit. Der Spurwechsel schafft hier neue Perspektiven: Anstatt jahrelang in Asylverfahren zu verharren, können Geflüchtete sich durch Arbeit und Ausbildung ein selbstbestimmtes Leben aufbauen.
Das könnte Sie auch interessieren

Neues aus diakonischen Unternehmen
Personalwechsel in diakonischen Unternehmen
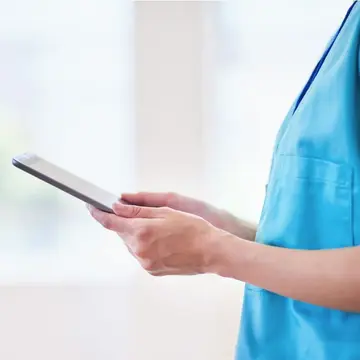
Politik trifft Praxis – Startet die Digitalisierung der Pflege jetzt durch?

Sozial-Investitionen stärken die Wirtschaft

Fünf Gründe für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr

Mit nachhaltiger Kleidung CO2 und Abfall sparen

Ankommen, um zu bleiben

Innovation trotz(t) Spardruck

Essen mit Verantwortung
