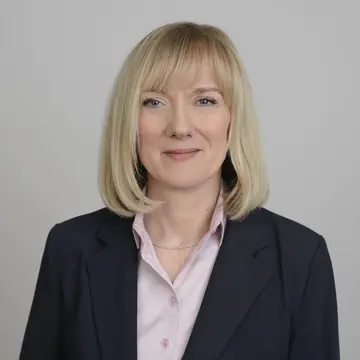Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung bietet großes CO2-Einsparpotenzial

Wie gelingt die nachhaltige Ernährungswende? Das ist ein Thema unserer kommenden Strategietagung Nachhaltigkeit. Im Vorfeld sprachen wir mit Prof. Dr. Melanie Speck und Julia Heinz, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema auseinandersetzen.
Zu den Personen

Prof. Dr. Melanie Speck forscht und lehrt seit 2021 an der Hochschule Osnabrück zu den Themen Haushalt und Betrieb. Zudem ist sie Senior Researcher am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH.

Julia Heinz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit im Lebensmittelsektor. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Vollverpflegung in der Außer-Haus-Verpflegung.
Das Thema Klimaschutz schien im Wahlkampf und den anschließenden Sondierungen weniger Priorität zu haben. Was folgt daraus für diakonische Unternehmen?
Speck: Unabhängig von der politischen Lage sollte man weiter progressiv vorgehen. Die Reduktionsziele der EU und auch Deutschlands gelten ja weiterhin, auch wenn die dafür notwendigen Maßnahmen nicht in der bisherigen Intensität verfolgt werden. Unabhängig davon, wer gerade Regierungsverantwortung hat, kann ich aus wissenschaftlicher Sicht nur dazu ermutigen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
Das EU-Parlament hat jüngst den betroffenen Unternehmen mehr Zeit für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeräumt. Verringert das die Dringlichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Heinz: Es ist gut, wenn sich die Unternehmen im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse mit ihrer Struktur auseinandersetzen und schauen, wo sie die größten Hebel haben, um Emissionen einzusparen. Das kann auch noch ganz andere positive Effekte haben: Unsere Beobachtungen zeigen, dass Unternehmen, die klare Nachhaltigkeitsziele definiert haben, eher neue Mitarbeitende finden und die Mitarbeiterbindung gesteigert wird.
Einer dieser Hebel, um CO2-Emissionen zu reduzieren, ist die Gemeinschaftsverpflegung, die Sie wissenschaftlich untersuchen. Welche Beobachtungen haben Sie gemacht?
Speck: Wir haben in verschiedenen Projekten sehr unterschiedliche Zielgruppen angeschaut: Von der Versorgung von Schülerinnen und Schülern über Pflegeeinrichtungen bis hin zu Betriebskantinen. Generell kann man sagen, dass die Speisepläne sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ausrichten sollten. Das hat nicht nur etwas mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun, sondern vor allem auch mit der individuellen Gesundheit. Ganz konkret bedeutet das zum Beispiel mehr Hülsenfrüchte und pflanzliche Öle zu verwenden und Fleisch und andere tierische Erzeugnisse zu reduzieren, ohne dass man darauf ganz verzichten muss.
Heinz: Wenn wir uns die Kaltverpflegung z. B. in Krankenhäusern morgens und abends anschauen, stellen wir fest, dass sich die Auswahl oft auf Wurst, Käse bzw. Butter und Marmelade beschränkt und rein pflanzenbasierte Aufstriche nicht angeboten werden. Da braucht man sich also nicht wundern, wenn sich die Klienten nicht für ein vegetarisches oder veganes Angebot entscheiden. Ich kann schon viel bewegen, wenn ich pflanzliche Alternativen anbiete und diese bei der Bestellauswahl oben auf die Liste setze.
Strategietagung Nachhaltigkeit 2025

Die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Berichterstattung nach CSRD-Richtlinie sind drängende Herausforderungen für Sozialunternehmen. Große Einsparpotenziale liegen im Scope3-Bereich, insbesondere bei der Verpflegung, Beschaffung und Mobilität. Diesem Thema widmen uns im Rahmen der 5. Strategietagung Nachhaltigkeit am 22. und 23. Mai 2025 in Berlin. Das Motto: Ran an die Wertschöpfungsketten! Das ausführliche Programm, die Teilnahmebedingungen, weitere Informationen und den Anmeldelink finden Sie im hier.
"Oder ich reduziere den Fleischanteil ..."
Wo läuft es besonders gut, wo sehen Sie Potenzial?
Speck: Generell kann man sagen, dass in Betriebskantinen oder der Hochschulverpflegung das Angebot schon breiter ist, weil die zur Verfügung stehenden Budgets höher und die Sensibilität für eine gesunde und nachhaltige Ernährung größer sind.
Heinz: In Einrichtungen wie einem Krankenhaus oder Seniorenheim, wo ein direkter Kommunikationsweg zwischen Küche und Verpflegungsteilnehmenden mitunter fehlt, ist es eher schwieriger. In den Senioreneinrichtungen kommen dann die Angehörigen, die viel Geld zahlen und dafür dann auch „das Fleisch auf dem Teller“ sehen wollen. Generell hängt es sehr an der jeweiligen Einrichtung, inwiefern man dem Thema nachhaltige und gesunde Ernährung Priorität einräumt.
Ist denn eine gesunde, nachhaltige Ernährung nicht viel teurer?
Speck: Der größte Kostenfaktor sind nicht die Lebensmittel, sondern die Personalkosten. Wenn ich das Personal vernünftig einsetze, kann ich den Kostendruck reduzieren. Am Ende habe ich vielleicht Mehrkosten von drei bis fünf Prozent.
Die Diskussion um „Veggie Days“ sorgte einst für viel Aufregung. Welchen Ansatz verfolgen Sie?
Heinz: Man kann schon mit kleinen Stellschrauben viel erreichen: In dem man beispielsweise Fleisch nicht als Hauptkomponente sondern eher als geschmackliche Ergänzung verwendet. Dann wird aus dem Fleischgericht mit Spitzkohl als Beilage beispielsweise eine Spitzkohlpfanne mit etwas Speckwürfeln. Oder ich reduziere in der Bolognesesauce den Fleischanteil und ergänze ihn mit Gemüse. Auf diese Weise lässt sich 30 bis 60 Prozent in der Co2-Bilanz eines Gerichts einsparen.
Welche Rolle spielt die technische Ausstattung, um Emissionen einzusparen?
Speck: Viel entscheidender als die Energieeffizienz der Küchengeräte ist die Stromversorgung: Das heißt die Verwendung erneuerbarer Energien. Aber bevor ich da anfange zu investieren, kann ich als Unternehmen in den Arbeitsprozessen, dem Beschaffungswesen und den Rezepturen ansetzen. Den größten Aufwand habe ich zu Beginn, in dem ich die Prozesse unter die Lupe nehme oder Zeit investiere, um mit dem Küchenteam beispielsweise neue Rezepte auszuprobieren.
Welche Relevanz hat das Thema Regionalität, bei der Beschaffung meiner Lebensmittel?
Heinz: Entscheidend ist, was ich wann auf den Teller lege – Stichwort: saisonale Produkte – und wie die Energieversorgung meiner Arbeitsprozesse gestaltet ist. Ein Steak vom regionalen Bio-Bauern hat immer noch eine deutlich schlechtere CO₂-Bilanz als Saisongemüse, das möglicherweise nicht direkt aus der eigenen Region stammt. Betrachtet man regionale Beschaffung isoliert, trägt sie nur begrenzt zur CO₂-Reduktion bei. Saisonale und regionale Aspekte müssen daher unbedingt zusammen gedacht werden!
Vielen Dank für das Gespräch.
Fragen: Tobias B. Ottmar
Ansprechpartner

Tobias-B. Ottmar
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Verbandskommunikation
Das könnte Sie auch interessieren
Personalwechsel in diakonischen Unternehmen

Neues aus diakonischen Unternehmen
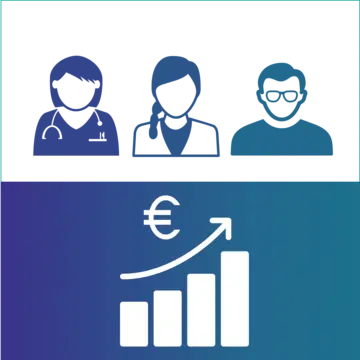
Diakonie: Gehälter steigen moderat in 2026

Nachhaltiges Essen muss nicht teurer sein

Pflegereform: Kurzfristige Lösungen zur Stabilisierung gefordert

Sozialwirtschaft muss vor Cyber-Angriffen geschützt werden

Starke Tarifbindung in diakonischen Unternehmen

Jedes Unternehmen kann Opfer einer Cyberattacke werden

Arbeitskräftestrategie: schneller, flexibler, integrativer