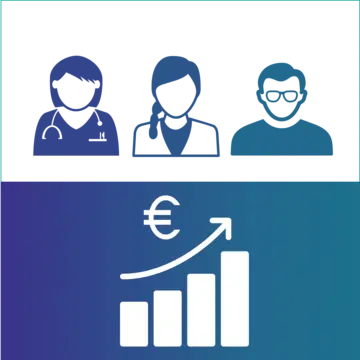Nachhaltiges Essen muss nicht teurer sein

Einer der größten Hebel zur Reduzierung der CO2-Emmissionen ist die Verpflegung. Der Gemeinschaftsverpflegung in den Einrichtungen der Diakonie kann dabei eine Vorreiterrolle zukommen – zumal die Umstellung auf eine nachhaltige Ernährung sogar Kosten sparen kann.
Durchschnittlich 160mal pro Jahr geht jede und jeder Deutsche außer Haus essen. Fleischbetonte Gerichte stehen zumeist an der Spitze der Beliebtheitsskala. Doch vegetarische Gerichte erobern zunehmend die Plätze in den Top Ten, zeigen beispielsweise die Menü-Charts eines der führenden deutschen Caterers Apetito. Bei der Verpflegung in Kitas und Schulen seien demnach inzwischen acht der zehn beliebtesten Menüs vegetarisch.
Deutschland isst ungesund
Doch in anderen Gemeinschaftseinrichtungen dominieren meist noch Gerichte mit tierischen Produkten die Speisekarte: Ob Currywurst, Rinderroulade oder Schnitzel – Fleisch als Hauptgericht ist vielfach noch Standard, Gemüse allenfalls Nebensache. Die Folge: Eine durchschnittliche Mittagsmahlzeit verursacht zwischen 1.000 und 1.200 g CO2-Äquivalente. Die Emissionen entstehen sowohl bei Produktion, Verarbeitung als auch Transport, Lagerung und Entsorgung des Lebensmittels. Eine nachhaltige Ernährung zielt auf einen Durchschnittswert von 450-600 Gramm CO2 pro Mittagsmahlzeit ab, sagt Prof. Dr. Melanie Speck von der Hochschule Osnabrück. Während Fisch, Fleisch und auch Süßes deutlich mehr verzehrt werden, als beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlen, werden in Deutschland noch zu wenig Obst und Gemüse sowie Nüsse und Hülsenfrüchte gegessen. Die negativen Folgen dieser ungesunden Ernährung sind in der individuellen Gesundheit spür- und anhand der volkswirtschaftlichen Kosten sogar messbar.
Strategietagung Nachhaltigkeit

Unter dem Motto "Ran an die Wertschöpfungsketten!" fand am 22. und 23. Mai die 5. Strategietagung Nachhaltigkeit in Berlin statt. Gemeinsam mit der Diakonie Deutschland und der KD-Bank beschäftigten sich die Teilnehmenden mit Einsparpotenzialen im Scope3-Bereich, insbesondere bei der Verpflegung, Beschaffung und Mobilität.
„Speckwürfelprinzip“ statt aufgezwungenem Vegetarismus
Die Lösung für das Problem liegt laut Speck aber nicht in einem aufgezwungenen „Vegetarismus“, sondern vielmehr im sogenannten „Speckwürfelprinzip“. Will heißen: Bereits ein mengenmäßig reduzierter Fleischanteil kann zu deutlichen CO2-Einsparungen führen. So werde aus dem „Schweinefilet mit Kohlgemüse und Kartoffelpüree“ dann eine „Spitzkohlpfanne mit Speckwürfeln und Kartoffelpüree.“ Und auch auf die in Pflegeheimen beliebten Königsberger Klopse muss nicht verzichtet werden: „Wer ein Drittel des Rindfleisches durch Dinkel oder anderes Getreide ersetzt, spart bereits 25 Prozent CO2-Äquivalente ein“, rechnet Speck vor. Dabei bleibe der Geschmack des Produkts weithin erhalten.
Menüplanung beeinflusst 80 Prozent der Emissionen
Insgesamt würde die Zutatenauswahl und Menüplanung bis zu 80 Prozent der Treibhausgasemissionen im Bereich der Verpflegung beeinflussen. Denn die vorgelagerten Prozesse der Produktion schlagen hier zu Buche Erst dahinter folge mit weitem Abstand der Energieverbrauch für die Produktion in den Küchen sowie die Emissionen durch den entstehenden (Lebensmittel)Abfall.
Bio-Kost für alle
Eines der diakonischen Unternehmen, das die Herausforderung zur nachhaltigeren Verpflegung angenommen hat, ist die Diakonie Stiftung Salem im ostwestfälischen Minden. Die Zentralküche produziert täglich rund 2.700 Mittagessen für Menschen zwischen 2 und über 100 Jahren: Die Menüs gehen an Kindergärten, Grundschulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder auch Senioreneinrichtungen. Die Küche muss sich dabei nicht nur auf unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten und -erwartungen der Zielgruppen einstellen, sondern auch den unterschiedlichen Kalorienbedarf im Blick haben. Mit einer vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Bildungsmaßnahme wurden die Mitarbeitenden im Küchenbereich geschult und sensibilisiert. Das Ergebnis: Heute ist die Zentralküche Bio-zertifiziert und hat bereits über 40 Bio-Lebensmittel in der Verwendung. Darüber hinaus wurde ein wöchentlicher „Veggie-Day“ in die Menüplanung integriert. Weiterhin kommt jede Woche ein frisches Frühstücksei vom eigenen Biohof Klanhorst in den stationären Einrichtungen auf den Tisch.
„Meat-woch“ statt „grüner Mittwoch“?
Auch die Evangelische Heimstiftung Stuttgart setzt als Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf eine nachhaltige Verpflegung. Die Einführung des „grünen Mittwochs“ – ein Tag ohne Fleischgerichte – sorgte Anfang 2023 für Schlagzeilen und rief sogar Patientenschützer auf den Plan. Intern sei die Anpassung jedoch von Mitarbeitenden und Bewohnenden unaufgeregt aufgenommen worden, berichtet Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider. Er könne sich sogar vorstellen einen Schritt weiterzugehen und aus dem „grünen Mittwoch“ einen „Meat-woch“ zu machen – den einzigen Tag, an dem es noch Fleisch gibt.
Vegane Gerichte sind deutlich günstiger
Aber nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes macht eine Anpassung der Gemeinschaftsverpflegung Sinn. Auch betriebswirtschaftlich rechnet sich eine Überarbeitung des Speiseplans und der Rezepturen, berichtet Prof. Dr. Speck. So sind beispielsweise die externen Kosten eines Gerichts, die sich aus Produktion, Weiterverarbeitung und Vertrieb zusammensetzen, bei einer klassischen Rinder-Bolognese mit 53 Cent pro Portion rund fünfmal höher als bei einer veganen Linsen-Bolognese. Großküchen sollten bei der Speiseplan-Erstellung die Konkurrenzgerichte im Blick behalten und verstärkt beliebte vegetarische Gerichte berücksichtigen. Ziel solle es sein, den pflanzlichen Anteil an der Ernährung auf bis zu 80 Prozent zu steigern.
Fazit: Eine angepasste Menüplanung, die sich an den DGE-Empfehlungen ausrichtet, schont das Klima, den „Geldbeutel“ der Unternehmen und die individuelle Gesundheit.
Ansprechpartner

Tobias-B. Ottmar
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Verbandskommunikation
Das könnte Sie auch interessieren

Ankommen, um zu bleiben

Innovation trotz(t) Spardruck

Essen mit Verantwortung

Gemeinsam die Digitalisierung voranbringen

Pflege: Dienstgeberverband fordert Abschlagszahlung bei Sozialleistungen

Neues aus diakonischen Unternehmen

Bürokratieabbau muss jetzt gelingen

Klemm: "Wir müssen uns am tatsächlichen Bedarf orientieren"
Personalwechsel in diakonischen Unternehmen