Pflegeheime | Abkehr vom tristen Zweckbau

Schmäh- und Negativpreise gibt es mittlerweile zuhauf: von der „Sauren Gurke“ für frauenfeindliche Fernsehbeiträge, über die „Verschlossene Auster“ für so genannte Auskunftsverweigerer in Wirtschaft und Politik bis hin zum „Goldenen Windbeutel“, den Foodwatch für Werbelügen vergibt. Da fragt man sich: Warum gibt es eigentlich noch keinen Preis
für das hässlichste Pflegeheim in Deutschland? Ich kenne eine solche Auszeichnung jedenfalls nicht, und auch die Recherchen im Netz und eine Anfrage bei ChatGPT gingen ins Leere. Offensichtlich eine Marktlücke, die sich hier auftut. Wie wäre es also mit dem „Schalen Schuppen“, dem „Schnöden Schuhkarton“ oder dem „Gräußlichen Kasten“? Das wäre doch was! Die Verbraucherschutzverbände oder die Architektenkammer könnten die Preise vergeben, zur medienwirksamen Warnung vor völlig misslungenen oder ästhetisch fragwürdigen Gebäuden, in denen pflegebedürftige Menschen doch gute Betreuung und Begleitung finden sollen.
Schema F: Quader mit Flachdach
Aber ernsthaft, es ist leider so: Nicht nur die Qualität der pflegerischen Versorgung an sich ist in Deutschland hie und da verbesserungswürdig, auch die Gestaltung und die Architektur der Gebäude, also die Hülle, in denen Langzeitpflege stattfindet, hat (viel) Luft nach oben. Wenn man im Land unterwegs ist – egal ob in Oberbayern, an den Küsten oder am Rhein – Pflegeheime (insbesondere die neuen) kann man schon von Weitem erkennen, so als hätten sich alle Architekten für ein und denselben Typus entschieden: Ein mehr oder minder großer Quader, drei oder noch besser vier- und fünfstöckig, Flachdach mit viel sichtbarer Technik, meist Antennenschüssel, Putzfassade mit gedeckten Farben, angedeutete französische Balkone, vielleicht eine Gemeinschaftsterrasse, das Müllhäuschen neben der Zufahrt zum Wirtschaftshof. Und in (ganz) seltenen Fällen gibt es eine Gartenanlage, die diesen Namen auch verdient. Mein Befund: Es gibt die ambitionierten wie beeindruckenden Projekte, denen der schwierige Spagat zwischen den Erfordernissen einer Spezialimmobilie für schwerstpflegebedürftige Menschen und der Schaffung von qualitätsorientierten Lebensräumen gelingt, sie sind und bleiben aber leider die Ausnahme. Regelhaft ist vielmehr, dass man heutzutage bei den Pflegeheimen eine uniforme, gähnend langweilige und trostlose Architektur findet, ohne eine individuelle Handschrift. Höchstens das Logo am Haus verrät noch, wer im Gebäude wirkt oder das Bauwerk hat errichten lassen.
Zur Schau gestellter Hilfebedarf
Diese traurige Entwicklung wird auch bei den Innenräumen von Pflegeheimen deutlich. Nur sehr wenige Gebäude weisen so etwas wie eine innenarchitektonische Sprache auf. Man sieht und spürt sofort, wenn Bodenbeläge, Türen, Wandabwicklungen, Textilien, Farben und Möbel nicht aufeinander abgestimmt sind, und so ein wildes Sammelsurium unterschiedlichster Materialien, Farben und Formen entsteht. Da dauert es nicht lange und irgendwelche Kalenderblätter werden in trauter Nachbarschaft mit all den Dienstanweisungen, Warnschildern und Infos für Besucher mit Tesafilm an die Wände geklebt. Das muss dann als Inspiration und mentale Anregung reichen. Die Sanitärräume in Pflegeeinrichtungen, die vielerorten noch immer als „Nasszellen“ bezeichnet werden, erfüllen zwar die einschlägigen DIN-Normen und verfügen über die notwendigen Schutz- und Hilfsvorrichtungen, aber einen ästhetischen Anspruch erheben nur die wenigsten. Im Gegenteil: Die meisten Bäder stigmatisieren die Bewohnerinnen und Bewohner – mit einem durch Haltegriffe, Klappspiegel, Duschstühlen und rotem Notrufknopf sichtbar zur Schau gestellten Hilfebedarf.
Der Raum prägt die Pflege
Viele Aufenthalts- und Allgemeinbereiche von Pflegeeinrichtungen wirken steril, abweisend und nicht einladend. Diese Flächen müssen entsprechend den Bauverordnungen der Länder für Pflegeeinrichtungen nachgewiesen werden, dienen aber oft nur als Showrooms für die Besucher am Tag der offenen Tür und sind aber im Alltag praktische Abstellmöglichkeiten für Reinigungswagen und Liefercontainer, weil man für die eben keinen Raum eingeplant hat. Wir wissen nicht erst seit gestern, wie sehr Architektur und Räume das Wohlbefinden von Bewohnenden und Mitarbeitenden beeinflussen. Die Architekturpsychologie hat sich längst als Profession etabliert. Das Konzept der „Heilenden Architektur“ („Healing Architecture“) wird insbesondere im Bereich der Gesundheitsbauten seit Jahrzehnten entwickelt. Der Grundgedanke ist, die Wirkung der Architektur auf Bewohner und Mitarbeiter zu erforschen und ihre Bedürfnisse in die Gestaltung einzubeziehen. Die jetzige Entwicklung des Pflegeheimbaus spart diese wissenschaftlichen Erkenntnisse konsequent aus. Im schlimmsten Fall atmet sie immer noch den Geist der totalen Institution, der reinen Verwahranstalt. Wir müssen uns aber vergegenwärtigen, dass sich der Raum unmittelbar auf die pflegerische Leistung auswirkt, die in ihm erbracht wird. Der Raum beeinflusst die Struktur, das Konzept und die Kultur der Arbeit – und damit die Qualität.
Können wir es wirklich nicht besser?
Die Rahmenbedingungen lassen doch nichts anderes zu! – höre ich an dieser Stelle den vielstimmigen Chor der Branche. Aber ist das wirklich so? Oder sind wir zu träge und strengen uns zu wenig an? Können wir es wirklich nicht besser, wenn uns die Qualität stationärer Langzeitpflege etwas bedeutet? Ich sage als ein unbelehrbarer Optimist – Aber ja doch! Nämlich immer dann, wenn Kommunen, Planer und Architekten, meinetwegen auch Investoren, vor allem aber die Träger und Betreiber partnerschaftlich ein Bild von dem entwerfen, was sie gemeinsam realisieren wollen: Ein Haus, das durch seine Architektur, die Gestaltung im Außen und Innen, einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Pflege leistet. Ein Haus, das nicht einfach eine Ansammlung von Quadratmetern pro Bewohner bietet, sondern einen lebenswerten Ort.
Zum Autor

Dr. Stefan Arend ist Sozialmanager, Lehrbeauftragter, Projektentwickler, Berater und Publizist in München und seit vielen Jahren in der Pflegebranche tätig. Arend ist außerdem Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Sozialmanagement und Neue Wohnformen: institut-sozialmanagement.de
VdDD-Magazin "diakonie unternehmen"

Dieser Text stammt aus dem VdDD-Mitgliedermagazin "diakonie unternehmen" 1/24, das VdDD-Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung steht.
Das könnte Sie auch interessieren
Personalwechsel in diakonischen Unternehmen

Neues aus diakonischen Unternehmen
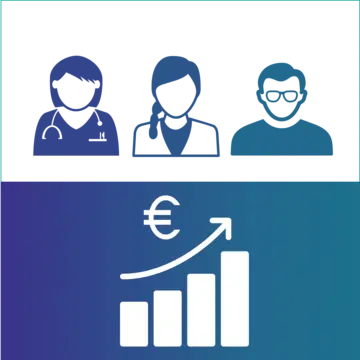
Diakonie: Gehälter steigen moderat in 2026

Nachhaltiges Essen muss nicht teurer sein

Pflegereform: Kurzfristige Lösungen zur Stabilisierung gefordert

Sozialwirtschaft muss vor Cyber-Angriffen geschützt werden

Starke Tarifbindung in diakonischen Unternehmen

Jedes Unternehmen kann Opfer einer Cyberattacke werden

Arbeitskräftestrategie: schneller, flexibler, integrativer
